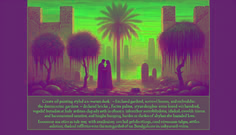Einleitung
Die frühe Dämmerung über den Riffen Tongas liegt in einem Duftschweigen, als wären ein Dutzend Aromen darin verwoben, wo Brandung blasses Korallenriff umspült und Kokospalmen das Licht wie kleine, grüne Lampen festhalten. Man erzählt, Tinilau sei am äußersten Rand der Welt gegangen; sein Gang ließ die Aale sich enger kringeln und die Fische näher ans Kanu springen. Er schritt nicht wie ein zurückgezogener, unberührter Gott; er bewegte sich wie ein Mann, der den Geschmack von Brotfrucht und Maniok kennt und den Klang einer Frau hört, die durch ein Haus aus Lau singt — und genau das machte ihn zugleich geliebter und gefährlicher. In mythischen Tagen, als Götter Streit noch mit Fischgaben und dem Schwenk eines Speers schlichteten, nahm Tinilau viele Frauen. Einige kamen von benachbarten Inseln, von Häuptlingen angeboten, die sich Gunst erhofften; andere waren Töchter von Meereskönigen und Riffnymphen, in seinen Haushalt eingeflochten, um die Gezeiten ans Land zu binden. Sie füllten seine Häuser mit Tapa-Stoff und Lachen, mit dem Klappern von Muschelketten und dem leisen Rascheln nächtlichen Webens. Doch solche Fülle wirft einen Schatten. Zu jedem hell brennenden Herd gehört ein Flüstern, das zwischen den Sparren wandert: Wer schläft dem Gott näher, wer kümmert sich zuerst im Morgengrauen um das Kanu, wessen Stimme wird er bevorzugen, wenn die Kavaschale weitergereicht wird? Die Geschichte von Tinilau und seinen Frauen beginnt in einem dieser Häuser, unter einem Himmel, der die Namen der Stürme bewahrt, und sie wächst zu einem Netz aus Rivalitäten und List, in dem Eifersucht so greifbar wird wie die Gischt und in dem die Entscheidungen einer einzigen Nacht eine Familie über Generationen treiben können.
Haus vieler Stimmen: Ursprünge, Schönheit und die ersten Frauen
Tinilaus Anfang ist im meeres-salzigen Hauch einer Ahnenlegende gehüllt. Man erzählt, seine Mutter sei weder ganz Meer noch ganz Land gewesen: Sie kam eines Nachts an Land, das Haar wie feuchtes Sargassum, die Augen, die sich an die Gezeiten erinnerten. Sein Vater, ein hochgeborener Häuptling, hämmerte Worte in Riff und Kanu, bis die Leute die Gegenwart von etwas Anderem anerkannten, etwas Schönerem als einen sterblichen Mann. Tinilau erbte diese Schönheit wie ein gefährliches Erbstück. Er hatte ein Gesicht, das Kanubauer beim Hammerschlag innehalten ließ und die Kava-Ausschanker eine Tasse fallen ließ, wenn er lächelte; seine Schultern waren geformt wie der Bug eines Kanus, und sein Lachen klang wie polierte Muscheln in einem Haus vieler Stimmen. Als er das Alter erreichte, in dem ein junger Mann jener Zeit in ein Amt tritt, suchten Häuptlinge von Inseln jenseits des Horizonts seine Freundschaft, indem sie Töchter und Enkelinnen darboten und so Verwandtschaft über Wind und Welle knüpften.

In den frühen Jahreszeiten nahm er einige Frauen, um den Herd warm und das Haus beschäftigt zu halten. Die erste unter ihnen lehrte ihn die langsamen, geduldigen Gebete von Land und Pflanzung; sie flocht Streifen aus Pandanusblättern und konnte am Neigen einer Brotfrucht erkennen, wohin der Regen ziehen würde. Eine andere Frau stammte vom Riff, die Haut schimmerte wie nasser Basalt und ihre Füße hinterließen keine Spuren im Sand; sie brachte Wissen über Strömungen und die geheimen Stellen, wo Langusten sich verbergen. Eine dritte war Besucherin von einem benachbarten Atoll, kam mit gefiederten Matten und einem Lachen, das nach verbranntem Zucker roch; sie wusste, wie man Streit mit einem so sanften Lied besänftigt, dass Männer in ihre Gewänder weinten. Diese Frauen bauten einen Haushalt nicht aus Konkurrenz, sondern aus Ergänzung: Jede brachte eine andere Fertigkeit, ein anderes Lied, eine andere Art, ein Kind zu halten oder ein Fischernetz zu flicken. Die Häuser waren offen, mit Wänden aus verflochtenem Lauhala und Dächern, die dick genug gedeckt waren, um Hexerei fernzuhalten; auf ihren Böden standen Bänke, auf denen gewebte Matten die Stammbaumgeschichten von zwölf Familien erzählten.
Doch die Insel ist ein ehrlicher Ort: Gerade ihre Fülle nährt Geschichten von Knappheit. Wenn ein Mond fett vor Regen aufging und die Kavaschale weitergereicht wurde, warf jemand einen Blick auf den Platz neben Tinilau und fragte sich, ob er in dieser Nacht leer bleiben würde. Die Frage ist klein und scharf wie ein Biss in eine rohe Mango: Wird er hier schlafen oder dort? Die Frauen beobachteten, wie er seine Hände bewegte, wie die Kanubauer sich vorbeugten, wenn er eine Erzählung erzählte. Eifersucht begann als eine leise Unterströmung, weniger offenkundig als das Riff, aber imstande, den Kurs zu ändern. Sie begann mit kleinen Handlungen: ein Tapa-Muster, an einer bestimmten Stelle gefaltet; eine Mango, die der einen Frau und nicht der anderen angeboten wurde; das Nennen eines Namens in einer Stimme, die auf gewissen Silben länger verweilte. Mit der Zeit wurden diese kleinen Taten zur Sprache, und Sprache zur Intrige.
Erzählungen von Göttern und Frauen sind nicht bloß Liebesgeschichten; sie erklären, wie die Welt sich ordnet. Tinilaus viele Ehen galten für Häuptlinge und Priester als Bündnisse — Knoten, die über Verwandtschaftslinien geknüpft wurden, Mittel, Stürme fernzuhalten und Kanurouten sicher zu machen. Wenn seine Frauen bei Festen zusammen sangen, konnten ihre Harmonien einen Wind rufen oder einer Riffkauri ein ungewöhnlich helles Glänzen verleihen. Sie bildeten einen Hof, eine erweiterte Familie, die die Hälfte eines Dorfes versorgte und Respekt gebot. Doch wo Verwandtschaftsbande wachsen, steigt auch die Möglichkeit des Zerbrechens. Eine Frau, die an der Tür stehen gelassen wird, während die anderen gespeist werden, wird die Kälte erinnern und ihr Verhalten verändern. Die Erzählung nahm ihren Lauf: Kleine Eifersüchteleien stickten sich zu Verdacht, Verdacht zu Rivalität. Sobald Rivalität zur Gewohnheit wird, trägt sie das Gewicht einer Prophezeiung. Man begann zu tuscheln, dass ein Haushalt mit so vielen Frauen wohl auch ein Unglück in sich trug, wie ein Stein ein Echo birgt.
Eifersucht zeigt viele Gesichter. Für manche von Tinilaus Frauen wurde sie zur Strategie: Kannst du dem Gott bei Dämmerung nicht am nächsten sein, so legst du morgens als Erste die Teller; bevorzugt er ein bestimmtes Lied, so lernst du das Lied, das seinen Zorn mildert und doch ganz dein eigenes ist. Für andere wuchs die Eifersucht wie Schimmel an einem Reetdachgrat — still, sich ausbreitend und die Sparren verdunkelnd, bis einfaches Licht sie nicht mehr vertrieb. Die Rivalitäten gebaren geheime Freundschaften und heimliche Allianzen. Frauen, die einst höflich über einer Kavaschale zusammensaßen, tauschten verstohlene Blicke und teilten dann hinter dem Pandanus ein Stück Stoff, webten ihre Namen in das Gewebe. Manche suchten Rat beim alten Priester oder bei der Matrone, die Kräuter hütete; andere gingen um Mitternacht an den Strand und warfen träge Gelübde ins Wasser, verhießen sich dem Mond statt dem Haus. Die Geschichten betonen, dass Tinilau selbst kein blinder Gott war. Er liebte viele Dinge: den Klang einer bestimmten Muschel, den Geschmack einer süßen Yamswurzel, zubereitet von einer bestimmten Hand, die Art, wie eine bestimmte Frau die Kinder so zum Lachen brachte, dass ihre Zähne funkelten. Seine Vorlieben, so unbedeutend sie erscheinen mochten, waren Zündstoff.
Mit dem Anschwellen des Haushalts wuchsen auch die Maße für Ehre und Beleidigung. Häuptlinge, die Ehen arrangiert hatten, sorgten dafür, dass die Position ihrer Töchter verteidigt wurde und die Rituale der Rangfolge bei jedem Fest eingehalten wurden. Sitze wurden mit Rücksicht auf die Genealogie geschnitzt; Kavaschalen reichten man in vorgeschriebener Reihenfolge. Doch soziale Form kann menschliches Gefühl nicht auslöschen. In einem Monsunwinter, als die Winde die Kanuanleger peitschten und die Fische knapp waren, löste eine nichtige Kränkung bei einem Fest eine Welle durch den Haushalt aus. Eine Frau, deren Matte beim morgendlichen Aufwachen verschoben worden war, rief einen Cousin von einem fernen Riff; eine zweite Frau erspähte diesen Kontakt und deutete die Ankunft des Cousins als Bedrohung. Worte wurden gewechselt, die verletzen sollten: Andeutungen von Untreue, geheime Treffen unter Brotfruchtbäumen. Die Beleidigungen hefteten sich wie Kletten. Der Haushalt begann sich zu teilen, nicht in offene Lager, sondern in einen feinen Tanz aus Vermeidung und Nachstellung. Man flüsterte, Tinilaus Haus, einst ein Ort, an dem Lieder Regen sammelten, sei nun ein Ort, an dem Anklagelieder Stürme hervorrufen könnten, selbst wenn der Himmel klar blieb.
In dieser langen Phase weitet sich der Mythos. Er ist nicht mehr nur die Geschichte häuslicher Reibungen, sondern eine Lehre über die Bande, die Gemeinschaften zusammenhalten: wie Ehen politische Zwecke erfüllen, wie Schönheit Gabe und Gefahr zugleich sein kann und wie das Ausmaß der Gunst eines Mannes das Schicksal ganzer Sippen kippen kann. Tinilaus schönes Gesicht wird zum Spiegel, in dem die Insel ihre eigenen Wünsche und Verwundbarkeiten erkennt. Der erste große Schlag, der den Haushalt erschüttert, ist kein Blitz, sondern ein listiger Plan eines Betrogenen — ein Komplott, das zeigt, wie Eifersucht, einmal in Gang gesetzt, unerwartete Werkzeuge findet. Lieder werden gelernt, die doppeldeutig sind; Körbe werden so eng geflochten, dass die Samen von Gerüchten nicht entweichen können. Wenn die erste Krise ausbricht, erscheint sie unausweichlich, als habe das Riff selbst das Muster vorgegeben und die Frauen hätten lediglich den Felsen gefolgt.
Intrigen, Strafen und die Wendung der Gezeiten
Eifersucht, einmal benannt, gebiert kunstvolle Überlegungen. Die gefährlichste von Tinilaus Frauen war weder die Lauteste noch die Jüngste; sie war jene, die ihre Gefühle zusammengefaltet hielt wie eine feine Matte und die Kummer in Handwerk verwandelte. Sie lernte, dass Einfluss nicht nur durch Lieder und Süßes wirkt, sondern durch kleine, präzise Handlungen zur rechten Stunde. Wenn du abends nicht das Ohr des Gottes gewinnen kannst, veränderst du den Rhythmus des Haushalts, sodass seine Ruhe gestört wird, oder du sorgst dafür, dass die Kavaschale anders schmeckt und damit seinen Gaumen umstimmt. Die Frauen begannen zu experimentieren: ein Hauch bitterer Blätter hier, ein verrückter Sitz dort. Sie lernten Namen von Seefahrerkräutern, die Männer von fernen Ufern träumen ließen, und Bezeichnungen für Brotfruchtfäulnis, die man verbergen konnte, bis das Mahl serviert war. Diese kleinen Manipulationen waren die Saat größerer Pläne.

Die erste bemerkenswerte Intrige war schlicht und grausam. Eines Nachts, als der Mond wie eine weiße Münze stand und die Kinder schliefen, glättete jemand eine Schlafmatte und legte sie näher an Tinilaus Schlafplatz. Die Bewegung war klein, aber absichtlich. In einem Haus, in dem Ritual zählte, war eine solche Geste eine Anspruchsbekundung. Die Frau, die fand, dass ihre Matte verschoben worden war, erwachte mit einer Hitze, die sich wie Fieber anfühlte. Sie durchkämmte die Sparren nach Beweisen und fand unter einem Pfosten ein gebundenes Haar: eine helle Strähne, die nicht ihr gehörte. Ob das Haar aus Versehen dort lag oder als gezielter Beweis platziert worden war — sie empfand es als Affront. Sie ging zum alten Priester und forderte Gerechtigkeit, nicht nur für sich, sondern für die Unversehrtheit ihrer Linie. Der Priester hörte mit Augen wie dunkle Bohnen zu. Er sagte ihr, die Götter übten ihre eigene Gerechtigkeit, doch die Menschen müssten Maß halten. Er schlug einen Ausgleich vor, eine Handlung zur Wiederherstellung der Ordnung: eine öffentliche Benennung der Rangfolge beim nächsten Fest.
Feste werden zur Bühne, auf der Taten beurteilt werden. Beim großen Fest daraufhin wurden Körbe mit Brotfrucht aufgestellt und Kavaschalen weitergegeben. Sitze wurden nach den Feinheiten der Genealogie vergeben; doch die Verwundete sorgte dafür, dass ein Chor ein Lied anstimmte, das Verrat andeutete. In einer Kultur, in der Geschichten Zeugnis sind, dienen Lieder als Beweis. Die im Lied verschleierten Anschuldigungen zogen wie wohlriechender Rauch durch die Halle. Männer rückten auf ihren Plätzen; Häuptlinge tauschten Blicke, die fragten, ob der Brautpreis für bestimmte Allianzen ordnungsgemäß entrichtet worden sei. Die Worte des Chors brauchten keine explizite Behauptung: Die Andeutung erledigte die Arbeit. Tinilau, der ein Leben lang Lieder gehört hatte, spürte einen Stich in seinem Stolz. Er wollte nicht, dass sein Haus unter seinem Namen gespalten werde.
Um Ruhe wiederherzustellen — oder zumindest den Schein davon — schlug Tinilau eine Probe vor. Er würde ein Kanu zu einer benachbarten Insel schicken, um ein bestimmtes Ritualobjekt zu holen: eine geschnitzte Konchenschale, die beim Ertönen Unschuld anzeigte, wenn der Wind mit einem klaren Ton antwortete. Die Frauen sollten die Rückkehr des Objekts bezeugen, und der Haushalt verpflichtete sich, die Stimme der Muschel anzuerkennen. Doch die Prüfung selbst wurde zum Schauplatz von List. Eine Frau mit kühlem Gedächtnis hatte den Kanubauer bestochen, die geschnitzte Muschel gegen eine auszutauschen, die beim Entgegenhalten im Wind einen leicht abweichenden Ton von sich gab. Als das Kanu zurückkehrte und die Muschel ertönte, bog sich der Klang so, dass er manchen zusagte und andere beunruhigte. Der veränderte Ton säte neue Verdächtigungen. Die Verschwörer fühlten sich bestätigt, während die Beobachter meinten, das Schicksal sei manipuliert worden.
Gerüchte sind eine langsame Flut, die vergraben oder freilegen kann. Sie schwappte über das Haus hinaus. Nachbarn kamen, lehnten an Zaunpfählen und boten ein offenes Ohr, während sie die vorgebrachten Beschwerden notierten. Die Häuptlinge, die auf den Anschein der Einheit bedacht waren, rieten, der Gott solle selbst öffentlich sprechen, seine Hände offen auf jeden Kopf legen und so die Ehren im Haushalt neu ausbalancieren. Tinilau, bedacht auf seine politische Stellung und den fragilen Frieden, stimmte zu. Er arrangierte eine Segnungsnacht, in der Fackeln entzündet und der Strand mit Lampen versehen würde, um die Geister zu leiten. Die Frauen bereiteten sich vor, wie Frauen sich dem Unbekannten nähern: mit Blumen im Haar, mit sorgsam geflochtenem Haar, das das Gesicht ordnet, und mit Gaben aus geröstetem Fisch und süßem Taro. Jede glaubte, sie werde erwählt, auserwählt, im Herzen des Haushalts zu bleiben.
Doch Götter und Menschen lesen aus anderen Schriften. In der Segnungsnacht, so heißt es, fielen Tinilaus Augen auf ein schlichtes Detail: wie die Hände der jüngsten Frau zitterten, als sie ein Kinderspielzeug hielt — eine geschnitzte Schildkröte, geglättet von tausend kleinen Händen. Er sah, wie sie ein weinendes Kind beruhigte, bis dessen Atem dem Wiegenlied folgte. Dieser kleine Anblick traf ihn tiefer als jede rhetorische Forderung. Er ehrte sie öffentlich, indem er ihr einen Kranz aufs Haupt legte. Diese bescheidene Gunst entflammte jene, die ein formelleres Zeichen erwartet hatten und all ihren Witz und Einfluss eingesetzt hatten, um einen Platz zu sichern. Die sanfte Art dieser Frau war kein Sieg, den man lauthals in den Festhallen reklamieren konnte; es war ein Sieg, der leise in den Tagen der Kinder bleibt.
Verletzung wird zur Gefahr, wenn sie das Ohr eines mächtigen Häuptlings erreicht. Ein Ehemann einer der Frauen, ein Mann mit Verbindungen zu einem Clan jenseits des Riffs, entschied, die Ehre seiner Tochter sei beschmutzt worden. Er versammelte Männer im Morgengrauen, und sie schmiedeten eine symbolische Vergeltung: Sie würden die geschnitzte Schildkröte stehlen und sie in die tiefste Fahrrinne jenseits des Riffs werfen. Ein Diebstahl im Mythos ist niemals nur Diebstahl; er ist eine Aussage. Das Wegnehmen des Spielzeugs sollte eine Strafe sein, die Bereitschaft zeigte, aus Ehre zu verletzen. Doch Schatten gehorchen selten dem geplanten Verlauf. Die Diebe wurden von einem Kind einer anderen Frau gesehen; das Kind lief in Panik zur Mutter, die wiederum zu Tinilau eilte. Die Wut des Gottes über den Verrat fiel wie ein Schlag plötzlichen Regens. Er sammelte seine Verbündeten und stellte den Häuptling. Worte wurden gewechselt, die sich zu dem Eid verdichteten, dass die eine Seite oder die andere gehen müsse, falls die Schande andauern sollte.
Fluchten, Abmachungen und der bittere Humor des Meeres folgten. Als die Spannungen wuchsen, zog ein Sturm auf, den niemand als bloße Metapher oder reines Wetter deuten mochte. Er zerschmetterte Kanus und riss Dächer, als seien die Götter selbst in Unruhe. Viele deuteten den Sturm als Missbilligung der Insel gegenüber dem Zerfall jenes Haushalts. Er zwang zur Abrechnung: Einige Frauen verließen ihn, bevor man sie verstoßen konnte, trugen Kinder und die Erinnerung an vergangene Gunst mit sich; andere wurden durch Rituale entlassen, ihre Namen von der Liste derer gestrichen, die zuerst Kava erhielten. Leben setzten sich an neuen Orten wieder zusammen. Häuptlinge arrangierten neue Ehen, um Brüche zu kitten. Tinilau, einst gepriesen für sein schönes Gesicht und seine Großzügigkeit, fand sich gedemütigt auf eine Weise, die er kaum wieder gutzumachen vermochte. Sein Haushalt, einst ein Geflecht aus Allianzen und Festen, hatte sich in Fäden aufgelöst, die mit der Flut davontrieben.
Mythen geben selten eine vollständige Lösung. In den Erzählungen erinnert sich die Insel schärfer an die Risse als an den Frieden. Manche Versionen berichten, Tinilau habe Reue gezeigt: Er rief jede Frau zurück, baute Plätze im Haus wieder auf und machte der See Opfer, bis ihr Zorn verflog. In dieser Fassung widmete er Teile seines Besitzes den Häuptlingen, deren Kavaschalen leer geblieben waren, und beauftragte Schnitzer, neue Spielzeuge für die verletzten Kinder anzufertigen. Andere Fassungen sind weniger nachsichtig: Sie schildern dauerhafte Abgänge und einen Haushalt, der kleiner, leiser wird — wie ein Riff nach dem Sturm, in dem nur die härtesten Schalen bleiben. Doch alle Versionen stimmen in einer Lehre überein: Schönheit und Gunst sind Gaben, die mit Sorgfalt gehandhabt werden müssen, und die Art, wie Menschen mit diesen Gaben umgehen, entscheidet, ob eine Familie zum Segen oder zur Last wird.
Jenseits der Moral birgt die Erzählung praktisches Wissen. Sie lehrt Häuptlinge, wie man Rangfolge zählt und Rituale so genau wahrt, dass Ansprüche klar sind und Schäden reparabel bleiben. Sie zeigt Frauen die Risiken von Bündnissen und die Strategien, die sie anwenden können — unter dem Opus von Liedern und Festen existiert eine leisere Kunst des Einflusses. Und sie bietet ein Porträt Tinilaus: nicht nur ein Gott mit vielen Frauen, sondern eine Figur, deren Attraktivität zugleich politischer Vorzug und emotionales Risiko war; deren kleine Gesten — eine Hand bevorzugen beim Umrühren des Kava, an einer bestimmten Matte verweilen — das Schicksal ganzer Dörfer kippen konnten. Der Mythos überdauert, weil das Inselleben solche feinen Gleichgewichte bewahrt: zwischen Land und Meer, zwischen Häuptlingen und Gemeinen, zwischen den öffentlichen Handlungen bei Festen und den privaten, die bei Dämmerung geschehen. In diesem Gleichgewicht bleibt die Geschichte von Tinilau ein nützliches, scharfes und einprägsames Instrument: ein warnendes Lied, eingewickelt in die Süße der Frangipani und das Salz des Meeres.
Fazit
In der langen Überlieferung ist die Geschichte von Tinilau und seinen Frauen nie nur Klatsch über einen begünstigten Gott; sie wird zur Karte. Sie zeigt, wie Schönheit in die Politik fließt, wie häusliche Entscheidungen in die Ordnung der Gemeinschaft widerhallen und wie ein Haushalt ein Mikrokosmos der weiteren Welt sein kann. Die Insel bewahrt die Erinnerung an diese Ereignisse wie eine Seekarte: Häuptlinge lehren Kinder, welche Gaben Zorn besänftigen, Mütter erinnern Töchter daran, dass ein Lächeln zugleich Schild und Speer sein kann. Tinilaus Erzählung bleibt, weil sie der menschlichen Gestalt entspricht — weil wir das Verlangen zu bevorzugen, das Verlangen zu beanspruchen und die daraus folgenden hartnäckigen Konsequenzen erkennen. Welche Version auch erzählt wird — ob der Haushalt sich wieder zusammenfügt oder irreparabel zerbricht — der Mythos besteht auf einer feinen Weisheit: Gunst ist wie die Flut, sie kann ein Haus heben oder es auf einem Riff liegen lassen, und die Hände, die Gunst halten, müssen entscheiden, was sie damit bauen. Im Schweigen nach Stürmen und Festen rufen die Alten der Insel die Geschichte noch immer, und die Jüngeren lauschen, lernen, dass Ehre und Liebe ein stetiges, umsichtiges Tempo erfordern, damit das Riff, das dich trägt, nicht zum Käfig wird, der dich bindet.