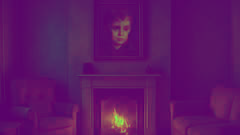Einführung
Nur wenige moderne Legenden haben die kollektive Vorstellungskraft des Vereinigten Königreichs so sehr gefesselt wie die Geschichte des Gemäldes „Der weinende Junge“. Es ist eine Erzählung, die leise beim Teetrinken geflüstert, in Online-Foren diskutiert und von Generation zu Generation weitererzählt wird – von Menschen, die schwören, selbst in die gequälten Augen geblickt zu haben. Für manche ist es nichts weiter als ein alter Kunstdruck – einer von Tausenden, die im Nachkriegseuropa produziert wurden und als Massenware in Wohnungen von London bis zu den windgepeitschten Terrassen Yorkshires hingen. Für andere ist es ein Vorbote des Unheils: ein verfluchtes Artefakt hinter geblümter Tapete, dessen tränenüberströmter Kinderblick für Feuersbrünste und Verwüstung verantwortlich gemacht wird. Über die Jahre befeuerten Zeitungsüberschriften den Mythos. Feuerwehrleute berichten von Häusern, die von plötzlichen Bränden heimgesucht wurden, in denen alles zu Asche verbrannte – bis auf ein einziges, unversehrtes Bild, das wirkte, als stünde es unter dem Schutz einer grausamen Macht. Skeptiker bringen rationale Erklärungen an, verweisen auf billige Materialien und urbane Legenden, doch jene, die selbst dem Bild ins starre Antlitz blickten, finden im Verstand wenig Trost. Für Familien, die Haus und Erinnerungen verloren, für Sammler, die das Bild aus Trotz aufhängen, und für Neugierige, die das Rätsel erkunden wollen, ist der „weinende Junge“ mehr als bloße Farbe auf Leinwand. Es ist eine moderne britische Geistergeschichte – eine Mischung aus Kunst, Tragödie und jenem unheimlichen Schauer, für den es keine Erklärung gibt.
Herkunft: Vom Atelier ins Wohnzimmer
Die Legende um den „weinenden Jungen“ entstand nicht in den Trümmern eines niedergebrannten Hauses, sondern in den geschäftigen Künstlerstudios Spaniens der 1950er Jahre. Das ursprüngliche Gemälde – eines von vielen – stammte von einem wenig bekannten italienischen Künstler, der seine Werke mit „Bragolin“ signierte. Hinter dem Pseudonym verbarg sich Bruno Amadio, der sich auf Porträts weinender Kinder spezialisierte: große, traurige Augen, zitternde Lippen, glänzende Wangen. Seine Motive sollten Mitgefühl und Melancholie hervorrufen, vielleicht sogar als Warnung vor Vernachlässigung dienen. Doch je weiter sich die Bilder in Europa verbreiteten, desto düsterer wurde ihre Aura.

In den 1960er und 1970er Jahren erkannten britische Importeure das Potenzial. Günstige Kunstdrucke vom „weinenden Jungen“ und seinen Begleitmotiven – das „weinende Mädchen“, das „weinende Baby“ – tauchten in Kaufhäusern und Versandhauskatalogen auf. Sie waren erschwinglich, massenproduziert und fanden ihren Weg in Tausende britische Haushalte. In gewisser Weise schien der traurige Kinderblick tröstlich – als könnte er das eigene Unglück erschnüffeln und aufnehmen. Für viele Arbeiterfamilien waren diese Bilder so gewöhnlich wie Spitzenvorhänge oder fliegende Enten an der Wand.
Derweil geriet der Maler selbst in Vergessenheit. Um Bruno Amadio rankten sich Gerüchte: Manche sagten, er malte die Kinder als Zeuge von Kriegszerstörung; andere flüsterten, seine Modelle seien Waisenkinder gewesen, denen Tragisches widerfuhr. Diese Unsicherheiten verstärkten nur noch die geheimnisvolle Ausstrahlung des Bildes. Niemand schien die wahren Ursprünge benennen zu können, doch fast jeder kannte jemanden, der so ein Bild besaß.
Jahrzehnte vergingen. Kinder wurden erwachsen, zogen aus und ließen das Bild zurück – es verstaubte in den Salons der Großeltern oder landete im Secondhandladen. Eine Zeitlang schien der „weinende Junge“ nur noch ein kitschiges Relikt des Nachkriegsdekorationsstils zu sein – bis das Schicksal, oder etwas Düsteres, das Bild zurück ins Scheinwerferlicht holte.
Die Feuerjahre: Zeitungsalarm und Feuerwehrängste
Die Wandlung vom sentimentalen Druck zum verfluchten Objekt kam plötzlich. 1985 titelte das britische Boulevardblatt The Sun auf der Titelseite: „Fluch des weinenden Jungen!“ Der Bericht schilderte eine Reihe rätselhafter Brände in Yorkshire und anderswo, bei denen ein weinender Junge stets als Kunstdruck an der Wand hing. Am erschreckendsten: Während das gesamte Inventar in Flammen aufging, überstand das Bild jedes Mal unversehrt den Brand.

Bald liefen die Telefone in den Feuerwachen heiß. Familien erzählten von nächtlichen Bränden: dem ätzenden Rauch, dem Schrecken – und dem seltsamen Fund des unbeschädigten Bildes im Aschehaufen. Einige schworen, sie hätten versucht, den Druck selbst zu verbrennen, nur um zuzusehen, wie er aus den Flammen auftauchte, als sei er von einer unsichtbaren Macht geschützt. Andere, die den Fluch loswerden wollten, warfen die Bilder auf den Müll oder verbrannten sie im Garten – dennoch kursierten Geschichten, das Bild tauche bald wieder auf oder nach der Entsorgung folge neue Katastrophe.
Die Presse witterte Sensation. Monat für Monat häuften sich Berichte: Ein Familie soll gleich drei Wohnungen durch Feuer verloren haben – immer nachdem eine andere Version des „weinenden Jungen“ im Wohnzimmer hing. Ein Rentnerpaar in Rotherham berichtete, dass ihr Appartement wenige Tage nach Erhalt des Bildes ausbrannte. Eine Frau aus Liverpool sagte, sie habe versucht, den Druck zu zerstören, und fand tags darauf ihre Küche in Flammen. Im Norden kursierten unter Feuerwehrleuten die haarsträubendsten Geschichten über den „Fluch“. Manche weigerten sich, überhaupt noch Häuser mit dem Bild an der Wand zu betreten – sie hätten zu oft erlebt, dass nur dieses Bild inmitten der Trümmer überdauerte.
Experten bemühten sich um rationale Deutungen. Chemiker verwiesen auf den hochwertig feuerhemmenden Lack des Drucks, der ihn beständiger machen könnte als Tapeten oder Möbel. Doch für jene, deren Leben aus der Bahn geworfen wurde, war das wenig Trost. Die Legende hatte längst Feuer gefangen und das Bild wurde vom harmlosen Dekorationsstück zum düsteren Omen: Sinnbild des Schicksals, das in jedem Pechvogel-Wohnzimmer lauerte.
Der Fluch greift um sich: Familien, Angst und Trotz
Ende der 1980er Jahre hatte sich die Furcht in den Gemeinden ausgebreitet. Bewohner von Sozialwohnungen warnten sich gegenseitig: Werft das Bild raus, sonst droht Unglück. Sozialkaufhäuser und Altkleidercontainer quollen über mit abgelegten Drucken, deren verweinte Gesichter zwischen alten Liebesromanen und angeschlagenem Geschirr hervorlugten. Mancherorts organisierte man sogar öffentliche Verbrennungen – Nachbarn trafen sich im Park, um Stapel der Bilder ins Feuer zu werfen. Trotzdem hielten sich Gerüchte, der Fluch würde dadurch erst recht verstärkt.

Innerhalb der Familien kam es zu Streit. Ältere Verwandte wollten das Bild behalten und behaupteten, es bringe kein Unglück. Jüngere bestanden auf Entfernung. Die Legende schlug immer wildere Blüten: Von Müttern, die nachts von den stummen Schreien des Kindes träumten, über Schüler, die Krankheit ihres Haustieres auf das Bild zurückführten, bis hin zu Teenagern, die behaupteten, das Bild habe sich bewegt, sobald sie wegschauten. In Kneipen und an Bushaltestellen wurden diese Anekdoten getauscht – manche tragisch, manche skurril, aber stets von einer nervösen Faszination durchzogen.
Gleichzeitig formierte sich eine Gegenbewegung. Skeptiker – Kunstliebhaber, Journalisten, Studenten – sammelten das Bild gezielt, hängten es gut sichtbar auf und luden Freunde ein als Zeichen des Trotzes. Manche verspotteten den Fluch geradezu, forderten ihn förmlich heraus. Es gab sogar Versuche, Dutzende Drucke nebeneinander in Ausstellungen aufzuhängen, um dem Aberglauben kollektiv entgegenzuwirken. Doch der Ruf des Bildes blieb ungebrochen. Sonderbarerweise schien jeder Brand in der Nähe ihrer Wohnungen die Legende weiter zu befeuern: Auch wenn es sich nur um Zufall handelte, war die Angst nicht mehr auszurotten.
Mit den Jahren verblasste die mediale Aufmerksamkeit, aber der Mythos des Bildes blieb Teil der britischen Folklore – wie Geschichten von Black Shuck oder Geisteranhaltern. In manchen Orten sorgt ein alter Druck auf dem Flohmarkt noch heute für nervöses Kichern oder misstrauische Blicke. Der Fluch war längst zu einem Teil des Alltagslebens geworden, der sich durch Fakten und Vernunft nicht so leicht vertreiben ließ.
Fazit
Noch heute, Jahrzehnte nach seiner ersten öffentlichen Verdammung, weigert sich die Legende um das Gemälde „Der weinende Junge“, in Vergessenheit zu geraten. Auf Flohmärkten und in Antiquitätenläden im gesamten Vereinigten Königreich taucht das traurige Kindergesicht noch immer hinter Trödelstapeln auf. Manche Käufer nehmen das Bild als Gesprächsanlass, andere als Scherz oder um ihr Glück herauszufordern. Doch viele gestehen – wenn auch nur im Flüsterton –, dass sie es niemals an ihre eigene Wand hängen würden. In Geschichten wie dieser steckt eine unheimliche Kraft: Sie machen deutlich, dass auch in Zeiten der Aufklärung Aberglaube seinen Platz behauptet, wo Gefühle tief sitzen. Der Fluch des „weinenden Jungen“ erzählt weniger von bösen Geistern als von der Angst, die von Nachbar zu Nachbar, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Er lebt fort in der Weitergabe – eine Lektion, wie gewöhnliche Gegenstände mit außergewöhnlicher Bedeutung aufgeladen werden können und wie Tragödien ihren Abdruck nicht nur auf Häusern und Herzen, sondern auf der ganzen Kultur hinterlassen. Noch heute verfolgen die Augen des Kindes jene, die vor dem Rahmen stehenbleiben – und verwischen die Grenze zwischen Möglichem und Unmöglichem, zwischen Glauben und Furcht.