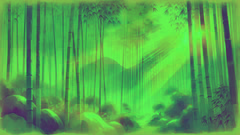Einleitung
Es gibt eine Mulde in der Welt, in der Nebel wie ein Gedanke liegt und das Land sich an das Tappen von Tieren und an Geschichten erinnert. Das Tal von Darragh barg einst mehr als Schafe und Steine; es führte ein Verzeichnis von Namen, ein Register aus Hecken, Bach und den kleinen Flüchen, die Menschen in die hohlen Hände murmelten, wenn ein Plan scheiterte oder ein Kind unartig war. Der Púca lebte in diesem Register, nicht als eine einzelne Gestalt, sondern als ein Überrest, ein Aufleuchten von Möglichkeiten am Rand des Begreifbaren. An manchen Nächten war er ein Pferd mit Augen wie nasse Kohlen, an anderen ein grinsender Mann mit zu vielen Zähnen, einmal eine Ziege, die summte wie ferne Kirchenglocken. Die Leute sagten, er sei ein Geist, verwandt mit dem Feenvolk, oder ein Teufel, geschickt, um Kindern Manieren beizubringen. Alte Mütter warnten ihre Jungen, eine Schale Milch an die Schwelle und einen Zweig ans Herd zu stellen, damit der Púca keinen nächtlichen Ritt auf einem schlafenden Körper nehme. Und doch, trotz aller Angst und trotz des Kochens von Brei mit einer Prise Salz, um Unfug fernzuhalten, sprach der Púca eine kompliziertere Sprache, als das Dorf übersetzen konnte. Er erfreute sich an den instabilen Winkeln menschlichen Lebens, an den Scharnieren der Entscheidung und an den kleinen Handlungen, die durch einen Huf, ein Flüstern oder eine plötzliche Veränderung der Haut rückgängig gemacht werden konnten. Auf diesen Seiten werde ich das Tal bitten, sich daran zu erinnern, was der Púca war und was er den Menschen bedeutete, die das Land mit ihm teilten; durchs Moor und die Gassen zu gehen, auf Huftritte im Morgengrauen und das Rascheln von Ziegenhaar im Ginster zu lauschen und Unfug gegen Barmherzigkeit in einer Landschaft abzuwägen, die selten einfache Antworten bot.
Ursprung und Vorzeichen
Das Tal erinnerte sich an den Púca, bevor er einen Namen hatte, und Namen veränderten das Wesen der Dinge. In der ältesten Überlieferung, die Seher und die Hüter langsamer Trauergesänge bewahrten, indem sie in torfschwarze Nächte sprachen, entstand der Púca, als die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Mehr-als-Menschlichen von Trauer gestreift wurde. Ein Kind war in einem Jahr magerer Gerste vom Fieber hinweggerafft worden, und die wilden Orte hatten auf das Wehklagen der Familie geantwortet, indem sie eines ihrer Wesen frei ließen. Ob die Kreatur aus Kummer entsprang oder durch das Kippen der Sterne, war für die Menschen, die mit Zeichen lebten, weniger bedeutsam als für Gelehrte; wichtig war, dass der Púca als Auftrag und als Rätsel kam. Er bot die Mechanismen des Wandels: einen nächtlichen Ritt, der einen Mann von einem bösen Traum befreien konnte, einen zerbrochenen Wagen, der sich plötzlich reparierte, einen Geliebten, der aufglitzerte und dann verwehrt wurde. Wer ihm begegnete, trug Spuren der Geschichte mit sich und das Wissen, dass die Welt Handlungsfähigkeit besaß.

Die Leute im Tal entwickelten Rituale fast aus Versehen. Wenn die Ernte ausfiel, stellten sie Schalen mit Milch hinaus; wenn das Vieh auf seltsame Weise abkalbte, legten sie Zweige und Steine in Mustern aus, um zu verwirren, was dem Neugeborenen Gefallen finden könnte. Der Púca mochte Muster, und er bewunderte die kleine Arithmetik des Aberglaubens der Menschen. Diese Handlungen wurden zu einer Sprache, einem Hin und Her: Menschen brachten Gaben, der Púca prüfte Grenzen, und die Gemeinschaften passten ihr Benehmen entsprechend an. Manche nannten ihn Wächter, andere einen Schalk, und einige, mit Augen, die die harten Kanten des Hungers gesehen hatten, nannten ihn grausam. Die Identität des Púca veränderte sich mit jeder Geschichte, die neben einem Torffeuer erzählt wurde. Für den Gutsbesitzer, der sein Landbrett behalten wollte, war er ein Agent des Chaos; für eine einsame Witwe war er ein Gespenst, das ihre Trauer manchmal so freigab, dass sie am Tage wieder erinnert wurde.
Doch der Púca scheiterte gelegentlich, und Scheitern lehrte. Einmal nahm er die Gestalt einer Ziege an, um einen jungen Burschen von einem Pfad an der Klippe wegzulocken; der Bursche folgte ihm nicht. Die Ziege kehrte zurück und fand ihren Huf gegen einen Stein gebrochen und den Burschen noch am Leben. Die Peinlichkeit des Púca war weniger eine menschliche Emotion als eine Fehlstellung in der Welt, ein Fehler im Register. Wenn ein Streich nicht gelang, zog sich das Wesen zurück und beobachtete, bis sich das Muster von Wirtshausgelächter oder Gebet von selbst wieder einstellte. Solche Fehlversuche nährten einen großen See des Skeptizismus unter den vorsichtigeren Leuten: Wenn der Púca durch einen einzigen Zweig oder eine plötzliche Freundlichkeit ausgetrickst werden konnte, dann ließ sich Unfug vielleicht mit kleinen, bewussten Güten begegnen.
Es gab Lieder über den Púca, die Kinder schlecht summten, Rhythmusfragmente, die ihnen die nötigen Ausweichmanöver lehrten. Man sagte: Reite nicht auf einem fremden Pferd bei Dämmerung, besteige nicht den Rücken eines Fremden, auch wenn er dir feines Silber anbietet; streue Salz auf deine Schwellen, sprich wahre Namen, wenn der Mond dünn ist. Namen zählten, weil Benennen ein Ding an einen Ort band. Ein Bauer konnte sein Feld nicht einfach fruchtbar nennen und erwarten, dass die Welt gehorchte; er musste es markieren, Dank sagen und seine Grenzen laut aussprechen. Der Púca hörte diesen Namen wie ein Fluss auf den Regen hört, und manchmal antwortete er mit einem Laut, der wie Hufe auf nassem Stein oder das Blöken eines so fernen Tiers klang, dass man ihn für den Wind halten konnte. So lehrte sich das Tal Vorsicht und eine Art Ehrfurcht. Mit der Zeit wurde der Púca zum Spiegel für die Menschen von Darragh: ein Wesen, das das Beste und Schlechteste widerspiegelte, wie die Gemeinschaft das Land und einander behandelte.
Nicht alle Begegnungen waren düster. Eine Hebamme behauptete einst, als das erste Kind, das sie in einem Frostjahr entband, schrie und nicht aufhörte, habe sie ein leises Trittgeräusch an der Tür und einen warmen Atem über ihrem Handgelenk gehört. Sie stellte eine Tasse süßer Milch auf die Fensterbank und fand sie im Morgengrauen unberührt vor, doch das Kind schlief. Die Hebamme erzählte es damals niemandem, doch die Geschichte sickerte wie eine langsame Blüte durchs Dorf. Sie deutete an, dass der Púca einen Kodex haben könnte, der zu bestimmten Stunden großzügig war und Schrecken gegen Hilfe eintauschte. Die Geschichten, die zu Vorschriften wurden, waren strenger: Lass Tore nicht offen, reise nicht allein bei Sonnenuntergang, nimm nichts, was nicht dir gehört. Doch eine Schattenversion bestand fort, die den Púca als Wesen zeigte, das ein seltsames Gleichgewicht zwischen Tadel und Beistand hielt. Gerade diese Zweideutigkeit sorgte dafür, dass er in Erzählungen weiterlebte, die wuchsen und sich teilten wie Wurzeln.
Rituale entwickelten sich aus häuslicher Notwendigkeit und lokaler Theologie. Menschen begannen, Wege mit Steinen zu markieren, in die Kreuze geritzt waren – manchmal um Heilige zu besänftigen, manchmal um einen Púca zu verwirren, der vielleicht einer bestimmten Spur nachging. Pferde wurden an bestimmten Tagen gesegnet, nicht nur von Priestern, sondern auch von Frauen in den Hütten, die summten und ihre Hände über die Flanken der Tiere strichen. Sogar die Erde selbst behandelte man wie einen launischen Nachbarn. Der Púca reagierte auf Aufmerksamkeit. Wo Hecken repariert und Wege von sorgsamen Füßen verbreitert wurden, neigte das Wesen dazu, sich so zu verhalten, dass diese Orte erhalten blieben; wo Fürsorge nachließ und Verbitterung herrschte, vermehrte es seinen Unfug. Die Moral jener alten Geschichten ist kein einzelner Satz; sie ist eine verflochtene Wahrheit: Verantwortung und Fürsorge machen das Wilde weniger zerstörerisch und die Wildheit weniger zur Ausrede. Der Púca war eine Art soziales Thermometer, das die Temperatur des Landes und der Menschen ablas und ihnen – mit Huf oder Flüstern – sagte, wann ihre Wärme zu schwinden begann.
Als die Welt außerhalb des Tals mit neuen Karten und Gesetzen vordrang, passte sich der Púca an – oder die Erzählungen, die hinausdrangen, passten den Púca an. Reisende und Tüftler trugen den Namen in Städte und Häfen, wo er zu einem Scherz oder einem stichartigen Angsthinweis für Kinder wurde, die den torfigen Duft der Heimat nie gekannt hatten. In diesen Nacherzählungen verschmolzen Galgenhumor und Folklore; der Púca wurde zur Pointe und zum Omen. Doch in den Tälern, in denen die Hecken ihre Erinnerung noch hielten, gingen die alten Tänze weiter: das Hinterlassen von Milch, das Platzieren eines daumengroßen Steins unter der Schwelle, das Vermeiden fremder Ritte nach Sonnenuntergang. Die Menschen lernten, mit einer Intelligenz zu leben, die – je nachdem, wie gut sie ihr Land pflegten – als böswillig oder barmherzig gelten konnte. Dieses Gleichgewicht prägte die Identität des Tals, und der Púca, als Spiegel und Unruhestifter, sorgte dafür, dass diese Identität nie ganz statisch blieb.
Begegnungen im Tal
Die Leute im Tal erzählten von Begegnungen wie Seeleute von Stürmen: mit Details, die sich zum Mythos abnutzten, und mit Spezifika, die kleine Wahrheiten bewahrten. Der Metzgerjunge, der den Púca als schwarzes Pferd gesehen hatte, beschrieb den Atem des Tieres als nach Farn und altem Regen riechend. Er sprach von einer Nacht, in der er, betrunken vor jugendlichem Übermut, sein Bein über den Rücken eines Hengstes geschwungen und die Welt habe sich geneigt angefühlt. Die Hufe des Pferdes zeichneten die Straße wie eine Trommel, und das Lachen des Jungen wurde dünn und fern. Er kam erst am Morgen zurück, als man ihn zusammengerollt hinter dem Dorfbrunnen fand, benommen und mit Torfrasen beschmiert. Er sagte, er sei bis zum Kamm außerhalb von Darragh geritten und zurück in einer Stunde, die seine Uhr fälschlich als die ganze Nacht bestehen wollte. Das Dorf hörte zu und sprach die Moral aus, die es bevorzugte: Vertraue fremden Tieren nicht. Andere, die andere Ausgänge erlebt hatten, hielten dagegen mit leiseren Geschichten, in denen der Púca jemanden eher aus der Gefahr trug als hineinführte.

Kinder standen in den Erzählungen vom Púca stets im Mittelpunkt. Sie waren, so die ältesten Mütter, durchlässiger für das Mehr-als-Menschliche. Ein Kind, das dem Klingen einer fremden Ziege lauschte, konnte ihr folgen, seine kleine Hand durch Rinnen gleiten lassen und an einen Ort geraten, den die Alten gar nicht als Ort betrachteten. Geschichten von Kindern, die vom Gesang verführt wurden, verfestigten sich zu Regeln. Doch es gab auch Berichte von Kleinen, die aus verwüsteten Gegenden zurückgebracht wurden, mit geröteten Wangen und Augen voller geheimem Himmel. Eine solche Erzählung stammte aus der Familie von Oonagh Keane, deren jüngster Junge fiebrig geworden war und nach einer Nacht, an die er sich nicht erinnern konnte, zerlumpt und lächelnd zurückkehrte. Er gab in der kindlich veränderten Weise Bruchstücke einer von Laternen gesäumten Straße wieder und eine Stimme, die nach Heu und altem Brot roch. Oonagh schwieg sorgfältig darüber, ob sie dem Bericht des Jungen Glauben schenkte; sie wusste, dass Glaube die Welt anders formt.
Bauern lernten ihre eigenen Ausweichmanöver. Wenn ein Feld keine Ernte brachte, gingen alte Arbeiter mit Glocken am Gürtel die Hecken entlang und banden Zweige mit Haar, um einen Púca zu verwirren, der seinen Unfug vielleicht aus den Wurzeln der Verzweiflung sprossen ließ. Solche Praktiken zeigen, wie menschliche Gewohnheiten das Muster des Wesens umgestalteten. Im Lauf der Jahrzehnte erhielten manche Wege im Tal eigene Namen: eine Biegung namens Fuchsgnade, wo Reisende schworen, von einem lachenden Mann mit zu weit knickenden Gelenken verfolgt worden zu sein; eine Senke namens Brautsruhe, in der eine Stute ohne Antrieb durch Reiter oder Peitsche in Galopp verfiel und mit einem Fohlen zurückkehrte, das neu von Sternen gekrönt schien. Diese Mikrogeschichten bildeten den Atlas des Tals, eine Karte nicht von Orten und Abgaben, sondern von Verletzlichkeit und Gnade.
Der Púca verfolgte auch die Beziehungen zwischen Nachbarn. Wenn zwei Familien über einen Streifen Gemeingrund stritten, nahm das Tier manchmal eine Gestalt an, die die Angst verstärkte, bis der Streit von selbst erlosch. In diesen Erzählungen war Rache oft kaum verhüllte Gerechtigkeit. Ein Streit um Weiderechte endete vielleicht damit, dass eine Familie ihre beste Kuh vermisste und Hufspuren wie blaue Flecken im Tau fand. Die vermisste Kuh kehrte Tage später seltsam wohlgenährt und sauber zurück. Die Nachbarn beschuldigten einander und ließen die Beschuldigungen fallen, als der Púca erneut in einer Gestalt erschien, die beide erschaudern ließ. Solche unbeholfenen Interventionen förderten Einigungen. Die Logik schien zu sein, dass die Landschaft Handel dem Blut vorzieht, und der Púca neigte, aus Gründen, die menschlichen Gesetzen unverständlich sind, dazu, Geschäfte zu erleichtern, indem er kleine Beispiele an denen gab, die ihre Abhängigkeit voneinander und vom Boden vergessen wollten.
Priester und Dichter stritten über das Wesen, als könnten sie es mit Doktrin oder Definition zivilisieren. Einige Priester predigten, man solle solchen Geistern keine Beachtung schenken; Frömmigkeit und Gebet würden den Púca machtlos machen, behaupteten sie. Dichter hingegen gaben ihm Persönlichkeit und Motiv, formten ihn zu einer Gestalt, die nur jene bestrafte, die es verdient hatten. Die Dorfbewohner aber überhörten die meisten Debatten im Stillen und kümmerten sich um das Praktische: Zäune wurden repariert, Gaben dargebracht, Kinder nach der Dämmerung in Reichweite gehalten. Geschichten gingen zwischen Nachbarn wie Wetterrezepte: ausprobiert, angepasst und weitergegeben. Die langsame, hartnäckige Praxis, mit dem Unbekannten zu leben, bildete die Weisheit des Tals.
Nicht jede Begegnung hinterließ Angstspuren. Es gab Nächte des Lachens, in denen eine zerlumpte Gruppe Schnitter beschwor, ein dunkles Pferd habe ihre Reihe von Sensen in einen fließenden Gesang verwandelt und sei dann mit einem Schnauben verschwunden, das wie jemandes Räuspern klang. Die Männer erzählten die Geschichte im Wirtshaus wie von einem großen Fang, schmückten sie aus und milderten die Kanten, bis selbst Skeptiker anerkennend nickten über die Demut kleiner, nicht erkaufter Freude. Solche Ereignisse knüpften die Gemeinschaft auf eine Weise zusammen, wie es eine einzelne bittere Tragödie nicht vermocht hätte. In diesen Versionen der Erzählung wirkte der Púca weniger als Strafender und mehr als Auslöser neuer Perspektiven und erinnerte die Menschen daran, wie rar und plötzlich Freude in einem Leben sorgfältiger Arbeit sein konnte.
Eine der beständigsten Begegnungen war die des Nachtreiters. Die Geschichten zeigten wiederkehrende Merkmale: eine fremde Kavalkade aus dem Nebel, das Donnern der Hufe in leeren Morgendämmern, und Menschen, die erwachten und ihre Sättel vermissten oder ihre Stiefel rätselhaft noch nass am Herd fanden. Diese Erzählungen fungierten als Metaphern für Risiko und Abrechnung. Ein Mann, der erwachte und fand, dass seine Felder besser sprossen als im Vorjahr, schrieb das einem Ritt zu, an den er sich nicht erinnern konnte; ein anderer, der mit einer Narbe zurückkehrte, die nicht heilen wollte, las in ihr vielleicht die Abrechnung einer unbezahlten Schuld. So wurden die Ritte des Púca zu einem Register: Zahlungen, die geleistet, unbezahlt oder auf rätselhafte Weise erlassen wurden, von einem Wesen, dessen Buchführung die Lebenden nicht ganz verstehen konnten. Durch solche Geschichten hielt das Tal sein Gleichgewicht: indem es seinen eigenen kleinen Schulden nachging und anerkannte, dass das Land selbst die Behandlung, die es erfahren hatte, richten könnte.
Im Laufe der Zeit, während das Dorf alternte und Jüngere in Häfen und Städte zogen, die sichere Löhne und neue Karten versprachen, veränderten sich die Geschichten erneut. Städter machten aus dem Púca ein Spektakel, ein Thema für Zeitungen und Ausstellungen statt für einen Nachbarn, mit dem man verhandelte. Doch das Tal bewahrte sein halb Misstrauen, halb Respekt wie Haare, die man aus einem alten Kleidungsstück gekämmt hatte. Selbst die Fortgezogenen nahmen einen Kern der Erzählung mit in ihr neues Leben und erzählten ihn in Räumen, in denen Torfrauch nur noch ein Gerücht und Mondlicht eine importierte Schablone war. Der Púca wurde so für viele vieles: Warnung, Wunder, Witz und – für die Hartnäckigen – ein Grund, Hecken zu reparieren und Schwellen zu salzen. Er gedieh am besten dort, wo das Land weder verlassen noch bis zur Unkenntlichkeit zurechtgemacht war, in den Grenzräumen, in denen Erzählung und Wetter sich kreuzbefruchteten und wo Menschen aus Gewohnheit noch Milch auf die Fensterbank stellten, nicht aus Aberglauben. Die Begegnungen setzten sich fort, ebenso die Arbeit, sie zu übersetzen.
Schließlich lehrte der Púca in diesen Begegnungen eine beständigere Lektion: menschliche Aufmerksamkeit verändert die Welt. Wird Fürsorge gezeigt – Zäune repariert, Klatsch dem Pflegen geopfert – schwand der Unfug des Púca. Herrschten Vernachlässigung, Gier oder Grausamkeit, wurde das Wesen aktiver und gezielter. Das ist keine ordentliche Moral, sondern eine Praxis: Kümmer dich um das Land und umeinander, und du wirst sehen, dass Neugier weniger gefährlich und lehrreicher wird. Wer solchen Geschichten lauschte, lernte mit weniger Gewissheit und mehr Geduld zu leben, verstand, dass ein Tal stets mehr Geschichten beherbergt, als ein Mensch tragen kann, und dass einige Wesen existieren, um zu verkomplizieren statt die menschliche Suche nach Sinn abzuschließen.
Die Nacht der Abrechnung
Die Nacht der Abrechnung kam weniger als ein Ereignis denn als eine Verkettung kleiner Erosionen. Jahre der Vernachlässigung hatten eine hartnäckige Kluft zwischen zwei Familien aufgeweitet, die einst Winterarbeit und Brot geteilt hatten. Der Streit begann um einen Streifen Moor, wo Schilf dicht und nützlich wuchs. Er dehnte sich aus und verfestigte sich zu Zwist, und Zwist zu Vandalismus: Zäune zerrissen, Werkzeuge verlegt, Beschimpfungen an Türen geschmiert. Das Land litt, und die Tiere reagierten mit Kopfweh und merkwürdigen Geburten. Es war die Art von langsamem Gift, das durch Routine geschluckt wird, bis jemand aufwacht und merkt, dass sich der Geschmack verändert hat. In einem Tal, das stolz auf die langsame, gemeinschaftliche Wiedergutmachung solcher Schäden war, wurde dieser Bruch zu einer Wunde, die jeder sehen konnte.

Als eine Herde Kühe in ein Feld brach und mit fehlenden Haarbüscheln und abwesenden Blicken zurückkehrte, trat der Dorfvorstand wie üblich zuerst im Wirtshaus und dann in der Kirche zusammen. Sie diskutierten ein Heilmittel: juristische Schritte, das Eingreifen von Priestern oder ein gemeinschaftliches Bußritual. Doch der Púca hatte eine andere Idee. Er erschien in jener Nacht als reiterloses Pferd, das Zaumzeug aus geflochtenem Farn und Silberfaden trug. Es ging die Grenze zwischen den Grundstücken ab und wählte dann eine Route, die weder auf Karten noch im Gesetz stand. Der Púca führte kleine Interventionen aus: Ein Tor schloss sich von selbst, eine Hand fand ein verlegtes Werkzeug, ein Kinderspielzeug rollte mit seltsamer, absichtlicher Präzision aus einem Schuppen hervor. Das waren kleine Wunder, und sie deuteten nicht alle auf eine unmittelbare Reparatur hin. Vielmehr waren es eine Reihe von Stupsern, die sich weigerten zu verraten, wen sie bevorzugten. Am Morgen fanden beide Familien ihre Hühner am Rand des umstrittenen Moores aufgereiht, die in einem synkopierten Rhythmus gackerten. Die Dorfbewohner deuteten dies als Zeichen: Das Land forderte einen Frieden, oder zumindest Aufmerksamkeit.
Was die Nacht besonders machte, war ein noch beunruhigenderes Ereignis. Ein Mann namens Tomas, der in Worten besonders scharf und in Taten verbittert gewesen war, ging nach Mitternacht hinaus, um seine Grenzpfähle zu prüfen. Er berichtete von einer Szene, die das ganze Dorf erschütterte: eine Prozession von Gestalten, die Reiter oder Bäume gewesen sein könnten, die durchs Moor zogen mit einem Klang wie ein Meer aus Schilf. Eine dieser Gestalten löste sich ab und stand neben ihm, und Tomas sah sie in der Gestalt eines Mannes mit einem Gesicht wie gesprungenes Leder und Augen, die weiß glühten. Dem Bericht zufolge sprach der Púca nicht, sondern presste Tomas’ Handfläche auf einen Stein und hinterließ einen Abdruck eines Hufs in seiner Haut. Tomas trug diesen Abdruck durch wache Wochen, und er juckte wie ein Versprechen. Er fühlte sich beobachtet und dann langsam, widerwillig, beschämt. Ob die Hufspur Illusion, Fiebertraum oder Urteil des Landes war, war weniger wichtig als die Tatsache, dass sie das Verhalten des Mannes veränderte. Tomas gab die Werkzeuge seines Nachbarn zurück, reparierte Zäune ohne Klagen und aß seine Mahlzeiten mit gemessenerer Stille. Die Gemeinschaft bemerkte den Wandel und glaubte, dass etwas jenseits ihrer kleinen Räte ihn herbeigeführt hatte.
Die Urteile des Púca glichen eher Spiegeln als Geboten. Sie spiegeln das wider, was ein Ort zugelassen hat, und was er braucht. Nach der Nacht der Abrechnung begannen die Menschen, mehr als Milch zu hinterlassen: Brot an Wegkreuzungen, Garben Gerste an Schwellen, kleine Päckchen gesalzenen Fleisches in hohle Bäume gelegt. Einige dieser Handlungen waren Beschwichtigungen, andere Opfergaben, wieder andere rein pragmatische Maßnahmen, damit Tiere nicht in Unfug geraten. Die Unterscheidung war wichtig für jene, die glaubten, sie könnten durch gute Taten ihr Schicksal ändern oder Gunst erwerben. Doch die älteren Frauen, die die Geschichten für alle bewahrt hatten, folgten einer älteren Rechnung: Der Púca hatte kein Konto von Guthaben, sondern eher Appetit auf Ausgleich. Wenn Ungerechtigkeit die Waage des Tals geneigt hatte, stupste das Wesen, bis das Gleichgewicht zurückkehrte. Es stupste mit Zähnen und Lachen, mit Huf und Flüstern, bis die Menschen sich neu einpendelten.
Nach den Reparaturen veränderte sich das Moor. Schilf, das verkümmert war, wuchs hoch genug, um einen neuen Pfad zu tragen. Das Feld brachte eine stabile und überraschende Ernte in einem Jahr, in dem die Nachbarländer versagten. Das bewies weniger die Wohltätigkeit des Púca als die Fähigkeit des Tals zu heilen, wenn seine Menschen sich daran erinnerten, es gemeinsam zu pflegen. Die Erzählung erstarrte zur Parabel über Zusammenarbeit. Jung und Alt erzählten sie später als Beispiel dafür, wie ungezügelte Gier die Wildnis so reagieren lässt, dass Gericht oder Predigt nicht genügen. Der Púca war weder Richter noch Retter; er war, in dieser Fassung, ein Bote, der Improvisation einfachen Moralpredigten vorzog.
Die besonneneren Dorfbewohner nutzten die Episode, um die Natur von Angst und Verantwortung zu prüfen. Sie setzten neue Muster für Verhandlungen: ein monatliches Treffen auf dem Grün, eine Liste gemeinsamer Aufgaben, die durch die Haushalte rotierte, und eine Art verbindlicher Schwur, dass jede Ernte einen bestimmten Anteil für die Gemeinschaft hervorbringen müsse. Diese Praktiken waren nicht nur praktisch, sondern auch performativ. Das Dorf inszenierte Fürsorge für sich selbst, damit der Púca weniger Bedarf verspürte, Unbehagen zu inszenieren. In diesen Ritualen lernte die Gemeinschaft eine Disziplin der Aufmerksamkeit: Es kostet Arbeit und guten Humor, Beziehungen zu den Lebenden und zum Mehr-als-Menschlichen zu pflegen.
In manch späterer Nacherzählung wurde der Púca milder; in anderen, strenger. Das Mark der Lehre blieb jedoch gleich: Vernachlässigen Menschen ihre Pflichten gegenüber Land und Nachbar, macht sich die Welt auf unbeholfene, manchmal gewalttätige Weise bemerkbar. Werden diese Pflichten erfüllt, wird die Welt sanfter. Der Púca wirkte hier wie eine Wetterfahne des menschlichen Verhaltens, drehte sich zu den Winden der Vernachlässigung und wies sie ab, sobald mit dem Flicken begonnen wurde. Die Geschichte ist weniger eine moralisierende Predigt als eine praktische Theologie: Der Boden erinnert sich daran, wie man ihn behandelt hat, und handelt nach dieser Erinnerung.
Mit den Jahreszeiten glättete sich die Erinnerung an die Nacht der Abrechnung zur örtlichen Gewohnheit. Kinder lernten die Namen der Grenzsteine zu sprechen, damit sie nicht vergessen würden. Bauern gingen zweimal im Jahr gemeinsam die Hecken ab. Der alte Tomas behielt den Hufabdruck für den Rest seines Lebens, einen blassen Halbmond auf seinem Handgelenk, der Kinder starren und Fremde Fragen stellen ließ, die sie zu höflich waren, zu Ende zu bringen. Auf Nachfrage sagte er, der Púca habe eine Art, Menschen ehrlich zu machen, wenn Ehrlichkeit am billigsten sei. Ob er die Geschichte als übernatürlich glaubte oder als Erzählung, die sein Leben veränderte, spielte weniger Rolle als die Tatsache, wie sehr sich sein Alltag änderte. Das Tal gewann ein unvollkommenes, zerbrechliches Gleichgewicht zurück, das wie alles Lebendige gepflegt werden musste. Der Púca zog sich in die Hecken zurück, zufrieden vielleicht mit dem Wissen, seine Arbeit getan zu haben und das Register in einen Zustand zurückversetzt zu haben, in dem menschliche Hände wieder ohne Furcht vor sofortiger Korrektur darauf schreiben konnten.
So lehrte das Tal sich selbst, neben einem Wesen zu leben, das von Unsicherheit lebte. Der Púca blieb präsent, manchmal ein Problem, manchmal ein Sprichwort. Die Menschen ließen weiter Milch stehen, sie hielten ihre Tore verschlossen und erzählten die Geschichte, wenn sie von Feld zu Feld gingen, und lehrten so der nächsten Generation das Handwerk der Aufmerksamkeit. Die Nacht der Abrechnung schloss mit einem eigentümlichen Frieden: der Erkenntnis, dass Störungen einen Zweck hatten und dass Reparatur Demut erforderte. In jenen Jahren erinnerte das Tal sich daran, nicht nur seine Zäune, sondern auch seine Geschichten zu pflegen, sodass die Erzählung vom Púca weniger eine Quelle des Schreckens und mehr ein Speicher gemeinsamen Sinns wurde.
Fazit
Geschichten überdauern, weil sie aufs Herz wirken wie das Wetter aufs Land. Die Geschichte des Púca handelt nicht bloß von einem Unfug treibenden Gestaltwandler; sie erzählt, wie eine Gemeinschaft lernt, in der Spannung zwischen Fürsorge und Vernachlässigung, zwischen Aberglaube und praktischer Güte zu leben. Der Púca ließ sich nicht sauber kategorisieren. Manchmal bestrafte er, manchmal half er, und oft fungierte er als Provokateur, indem er den Menschen die Konsequenzen ihres Handelns zeigte, indem er ihre Welt umstellte. Die vielen Fassungen der Erzählung erinnern daran, dass die Grenze zwischen Wunder und Furcht porös ist und dass Erzählung selbst Teil der Arbeit des Hegens der Welt ist. Wenn es eine Moral gibt, dann ist sie praktische: Achte deine Schwellen, mend deine Zäune und erinnere dich daran, dass Aufmerksamkeit Ergebnisse verändert. In diesem Erinnern liegt die wahrere Art von Magie, die Hecken gedeihen lässt, Kinder von den Rändern zurückkehren und Nachbarn Gründe finden lässt, beieinander am Herd zu sitzen. Lebe mit Fürsorge, und der Unfug des Púca wird meist eher ein Impuls zum Heilen als zur Zerstörung sein. Lass Vernachlässigung wuchern, und das Land wird in seiner eigenen Sprache sprechen, bis die menschlichen Zuhörer endlich lernen, sie zu übersetzen.